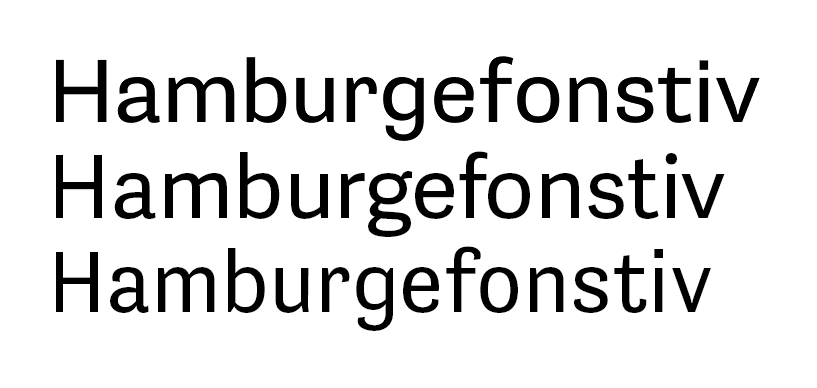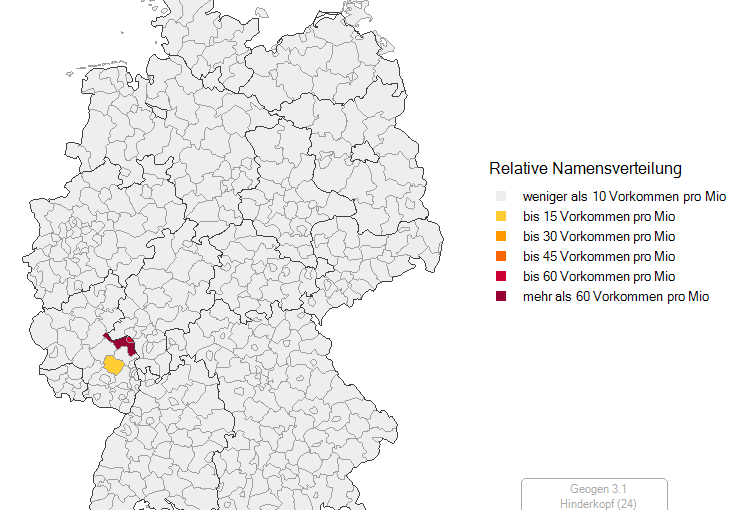Einige Impressionen vom vielleicht größten, sicher aber schönsten Martinsumzug der Welt:

Der Beginn des Zuges verzögerte sich um rund 15 Minuten – wegen eines gewittrigen Hagelschauers, der manche der Fackeln bereits vor dem Start beschädigte.

Schüler einer Klasse des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums (LvD) hatten ihre Fackeln als großbrüstige Nana-Figuren im Stil Niki de Saint Phalles gestaltet.

Neben Freiheitsstatuen kamen auch Eiffeltürme als Fackeln zum Einsatz. Diese hatten den Regen und Hagel besser überstanden als die meisten anderen Kunstwerke.

Schüler des Gymnasiums Thomaeum hatten einen 17 Meter langen Drachen gebaut, dem das Wetter dank Stoffkonstruktion und elektrischer Beleuchtung wenig anhaben konnte.

Wohnungen, Läden, Parkfläche – all das soll der im Bau befindliche Klosterhof in der Innenstadt von Kempen in Kürze bieten. Für Ende November ist die Eröffnung der Tiefgarage angekündigt. Aber noch ist das Gebäude eine unbewohnte Großbaustelle und konnte deshalb mit bunter Folie vor den Scheiben in eine überdimensionale Fackel verwandelt werden. Hübsche Idee!

Auch Privatleute – wie hier in der Alten Schulstraße, ohnehin eine der pittoreskesten Ecken der Stadt – haben sich viel Mühe mit der Dekoration gemacht. Und es sieht auch noch schön aus.

Rechts im Hintergrund wird St. Martin von den tagesthemen interviewt, die über den Zug berichteten, und im Vordergrund flackert das Martinsfeuer. Darauf ein paar Püfferkes!